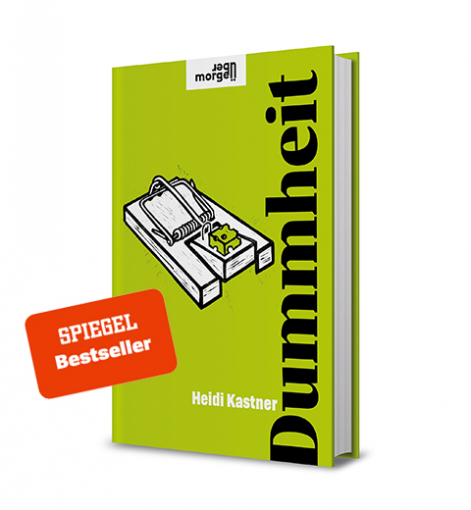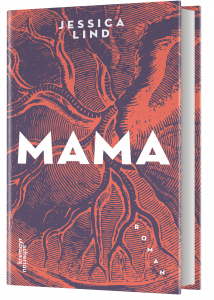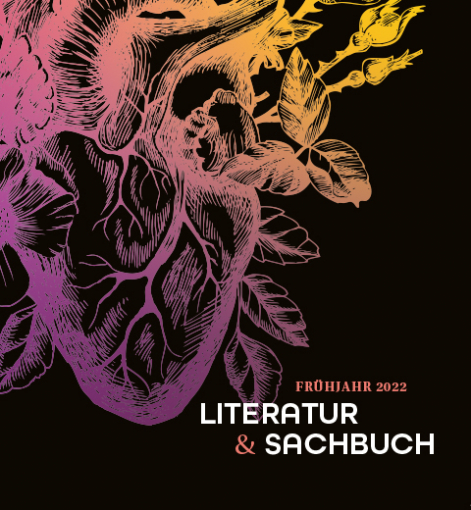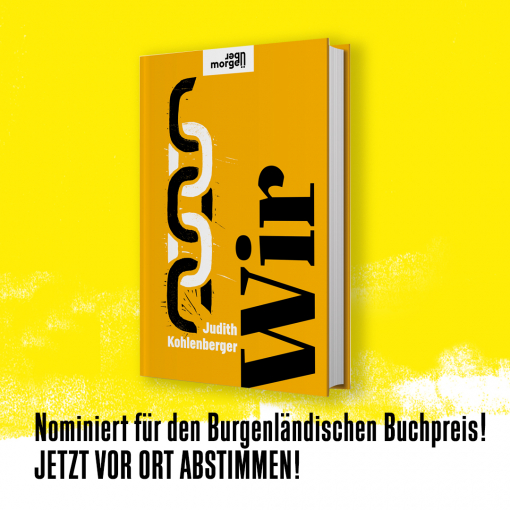Dein Protagonist und du, ihr habt denselben Beruf: Totengräber. Was fasziniert dich an dieser Tätigkeit?
Am Ende des Tages wohl einfach die Routine. Das immerwährende Sujet des Grabens, während ringsherum das Leben stattfindet. Ein Loch ausheben. Ein Loch zuschütten. Der Vergänglichkeit zuarbeiten. Ähnlich wie es Albert Camus in seinem „Mythos des Sisyphos“ beschrieben hat. Statt eines Steins rolle ich eben Särge. Und nicht zuletzt das simple Gefühl, etwas geleistet zu haben, nicht nur für sich selbst. Seit mein Papa mit dieser Arbeit begonnen hat, als ich ein Kind war, ist sie auch irgendwie Teil von mir selbst geworden. Um es mit meinem dramagebeutelten Protagonisten zu sagen, vielleicht sogar eine Berufung. Und so wie sich die Begräbnissituation gerade entwickelt, gehöre ich möglicherweise der letzten Totengräbergeneration überhaupt an, worin auch so etwas wie Poesie liegt. Der Totengräber stirbt ja aus.
Wie viele Gräber gräbt der Protagonist im Laufe des Romans?
Für jede gescheiterte Liebe eines. Vielleicht sogar mehr. Poetisch gesprochen. Rein praktisch: ca. 30 – wenn der Roman ein Jahr umspannt.
Friedhöfe sind …?
… Orte der Kontemplation. Bei Reisen besuche ich meist gleich den Friedhof, um irgendwie anzukommen – Ruhe zu finden, wo Zeit keine Rolle mehr spielt. Und literarisch betrachtet bieten Friedhöfe einen unendlichen Schatz an Lebensgeschichten.
Welche Rolle spielt Einsamkeit in deinem Roman?
Mein Protagonist gehört eher zum Typus: Krustentier. Es fällt ihm unheimlich schwer, eine Sprache zu finden, um seine Gefühle verständlich zu machen, und so zieht er sich immer weiter in sich selbst zurück, bis er eine Welt in sich geschaffen hat, die die da draußen nicht mehr braucht und sich wie ein Perpetuum mobile aus Erinnerungen und Vergangenem nährt. Der Roman, und alles was mit dem Protagonisten darin passiert, ist im besten Fall ein Aufbrechen dieser Schale, um zu sehen, was dann passiert.
Der Roman liest sich wie ein Tagebuch. Wieso hast du diese Form gewählt?
Die Form hat eher mich gewählt. Ich bin ein begeisterter Leser von Autobiographien, Briefen und Tagebüchern – quasi jeder Art von Selbstdarstellung. Für den Roman wollte ich zum Ursprung des Schreibens zurück und mich soweit wie möglich dort hineingraben – also hin zu den Momenten, bevor das Schreiben zur Literatur wird. Letztlich hat mich auch einfach die Frage interessiert: Wie lässt sich in einer überinszenierten Welt, in der jede Handlung schon Selbstdarstellung ist, sein eigenes Leben als Kitschroman deuten?
Wie setzt du die Grenzen des autofiktionalen Erzählens?
Die Grenze habe ich für mich bewusst aufgehoben, weil jedes Erzählen bereits ein fiktionaler Prozess ist. So heißt es etwa im Roman: „Authentizität ist ein Mythos für Menschen ohne Vorstellungskraft.“ Umgelegt auf den Schauspieljargon würde ich eher von einem „Method-Writing“ sprechen.
Im Roman ist zu lesen: „Das Ich möchte Wurzeln schlagen, aber die Sprache bleibt Treibsand.“ Welches Verhältnis hat der Protagonist zur Sprache?
Einerseits hätte mein Protagonist ohne Sprache seinen letzten Rettungsanker im Leben verloren. Die täglichen Notizen geben ihm Halt, wobei sie ihn andererseits am Weitergehen hindern. Zentraler Konflikt ist hier, dass er mit dem Erwachen seiner ersten Liebe zu schreiben begonnen hat und jetzt ständig alte Wunden aufkratzt. Gibt es eine Sprache für ihn ohne diese Liebe oder muss er schweigen?
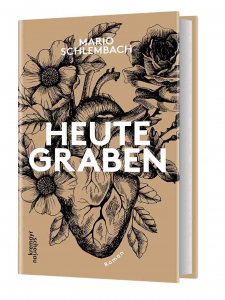
Was bedeutet A. für den Protagonisten?
In jemand anderem sich selbst zu finden. Mein Protagonist lernt A. kennen, noch bevor er weiß, wer er ist oder sich auch nur irgendwelche Gedanken darüber gemacht hätte. Sein Ich erwächst aus der Liebe zu A. – ohne zu sehen, welcher Mensch ihm da gegenübersitzt. Bevor er das versteht, ist A. verschwunden und sie bleibt unbändige Sehnsucht – Unabgeschlossenes, das er nicht loslassen kann und in allen anderen Frauen zu suchen beginnt.
Lässt sich Liebeskummer von der Seele schreiben?
Akut definitiv nicht. Als Teil des Prozesses schon. Vor allem das Tagebuchschreiben bleibt ja immer ein Selbstgespräch, und ohne den Blick von außen kann es schnell zu einem Suhlen in den Eigensäften werden. Gleich wie bei der Trauerarbeit ist das Loslassen erst möglich, wenn der Blick wieder nach vorne gerichtet wird. Meist sind dafür andere Menschen und das Ausbrechen aus Gewohnheiten unabdingbar.
Welche Autor*innen bzw. welche Bücher haben dein Schreiben beeinflusst?
Für „heute graben“ die Tagebücher von Franz Kafka. Der Alltagston, der dort angeschlagen wird, in Verbindung mit literarischen Wunderstücken, hat mich immer fasziniert. „Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag Schwimmschule“, heißt es darin etwa, was den Kampf eines Subjekts im Wahnsinn seiner Zeit widerspiegelt. Hier entstehen Brüche in der Sprache, die in anderen Gattungen so kaum möglich sind. Und Thomas Bernhard war für mich als Autor relevant, weil ich mich während des Studiums so sehr in sein Werk und Leben vertieft habe, bis, aus irgendeinem absurden Zufall heraus, ich mit derselben Lungenkrankheit wie er diagnostiziert wurde und wir plötzlich zu Leidensgenossen wurden. Die Auseinandersetzung mit dieser Krankheit hat mir letztlich auch den Rahmen für meinen Roman geliefert. Fern von diesen zwei Autoren waren es dann hauptsächlich die Liebesschinken, die meine Mama jeden Morgen zum Frühstückskaffee las, bevor ich in die Schule musste.
Blunzengröstl, Schnitzel und Bier. Typisch Totengräber oder typisch Österreicher?
Typisch österreichische Wirtshauskultur und Omas Kochkünste. Die Menüauswahl beim Leichenschmaus ist ja leider eher monothematisch.
Heute graben, morgen …?
… ein bisserl leben vielleicht.
Vielen Dank!
Wien, 26.01.22 / Das Interview führte Roxana Höchsmann