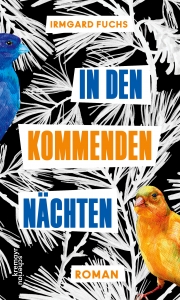Wir freuen uns über die vielen Auszeichnungen und Preise der vergangenen Jahre und gratulieren unseren AutorInnen. Die Liste wird laufend ergänzt.
2023
- Simone Hirth
Frau Ava Literaturpreis - Judith Kohlenberger
Wissenschaftsbuch des Jahres - Gerhard J. Rekel
ITB BuchAward “Das besondere Reisebuch”
2022
- Maria Muhar
Shortlist, Rauriser Literaturpreis - Iris Blauensteiner
Longlist, Österreichischer Buchpreis - Iris Blauensteiner
Buchprämie der Stadt Wien für “Atemhaut” - Getraud Klemm
Anton-Wildgans Preis 2022 - Paul Lendvai
Concoria Ehrenpreis für das Lebenswerk - Jessica Lind
Bloggerpreis “Das Debüt” 2021
2021
- Simone Hirth
Reinhard-Priessnitz-Preis 2021 - Romina Pleschko
Nominierung Franz-Tumler-Literaturpreis - Gertraud Klemm
Ernst-Toller Preis - Paul Lendvai
Bruno-Kreisky-Preis für publizistisches Gesamtwerk - Judith Kohlenberger
Förderungspreis der Stadt Wien
2020
- Karim El-Gawhary
Außenpolitikjournalist des Jahres - Gertraud Klemm
Outstanding Artist Award - Lucia Leidenfrost
Shortlist, Das Debüt - Irmgard Fuchs
Xylophon-Preis für das zweite Buch
- Stephan Roiss
Longlist, Deutscher Buchpreis - Elisabeth Lechner
GAIN Gender & Agency Forschungspreis für Dissertation 2020
2019
- Tonio Schachinger
Shortlist, Deutscher Buchpreis
Bremer Förderungspreis
Shortlist Rauriser Literaturpreis - Irmgard Fuchs
Buchprämie des BKA - Lucia Leidenfrost
Jahresstipendium für Literatur des Ministeriums für Kunst und Wissenschaft, Baden-Württemberg - Marie Luise Lehner
AK-Literaturpreis
2018
- Karim El-Gawhary
Außenpolitik-Journalist des Jahres (Der Österreichische Journalist)
Axel-Corti-Preis - Rhea Krcmarova
Buchprämie der Stadt Wien - Angelika Stallhofer
Österreichische Buchprämie für besonders gelungene Neuerscheinungen - Paul Lendvai
Europäischer Buchpreis - Verena Stauffer
Shortlist Bloggerpreis “Das Debüt”
Nominierung zum Alpha Literaturpreis
Longlist, Hotlist der unabhängigen Verlage
Projektstipendium des Bundeskanzleramts Österreich - Petra Piuk
Finalistin beim Alpha Literaturpreis
Wortmeldungen-Literaturpreis der Crespo Foundation
Shortlist, Literaturpreis “Text & Sprache”
Shortlist, Burgenländischer Buchpreis - Renate Silberer
Werkzuschuss aus dem Jubiläumsfonds der Literar Mechana - Iris Blauensteiner
Förderungspreis der Stadt Wien - Thomas Mulitzer
Start-Stipendium des Bundeskanzleramts Österreich - Barbara Rieger
Start-Stipendium des Bundeskanzleramts Österreich - Andrea Stift-Laube
Projektstipendium des Bundeskanzleramts Österreich - Marianne Jungmaier
Projektstipendium des Bundeskanzleramts Österreich - Simone Hirth
Literaturstipendium Baden-Württemberg - Lucia Leidenfrost
Literaturstipendium Baden-Württemberg
Start-Stipendium des Bundeskanzleramts Österreich
2017
- Marie Luise Lehner
Alpha Literaturpreis
Start-Stipendium des Bundeskanzleramts Österreich - Elfriede Hammerl
Lebenswerk-Preis - Hans-Henning Scharsach
Bruno-Kreisky-Sonderpreis für das Politische Buch - Andrea Stift-Laube
Jubiläumsfonds-Stipendium der Literar Mechana - Verena Stauffer
Manuskripte-Förderungspreis - Marianne Jungmaier
Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds - Simone Hirth
Shortlist Alpha Literaturpreis
Hans-Weigel-Literaturstipendium des Landes NÖ - Iris Blauensteiner
Shortlist Alpha Literaturpreis
Aufenthaltsstipendium, Literarisches Colloquium Berlin2016
- Erhard Busek
Donauland-Sachbuchpreis - Marianne Jungmaier
Buchprämie des Bundeskanzleramts für besonders gelungene Neuerscheinungen
George-Saiko-Preis - Petra Piuk
Literaturpreis des Landes Burgenland
Finalistin beim Floriana-Literaturwettbewerb
Buchprämie der Stadt Wien - Karim El-Gawhary
Leopold-Kunschak-Pressepreis - Daniel Zipfel
Buchprämie der Stadt Wien
Buchprämie des Bundeskanzleramts für besonders gelungene Debüts - Irmgard Fuchs
Buchprämie der Stadt Wien - Ianina Ilitcheva
Buchprämie des Bundeskanzleramts für besonders gelungene Debüts - Tom Gschwandtner
Live goes on award
2015
- Rhea Krčmářová
Literaturpreis Wartholz des Landes NÖ (für die Erzählung ‘Inselhüpfen’)
2014
- Gudrun Harrer
Bruno-Kreisky-Preis für das publizistische Gesamtwerk

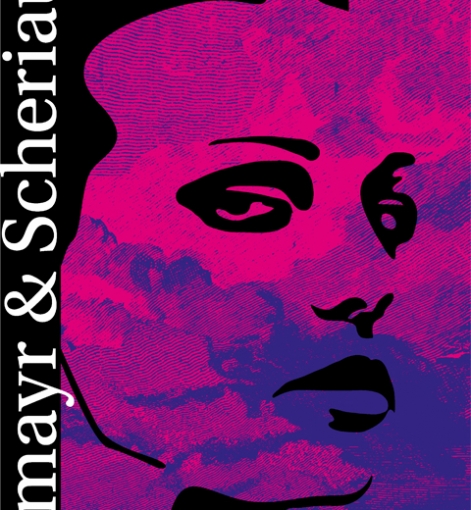
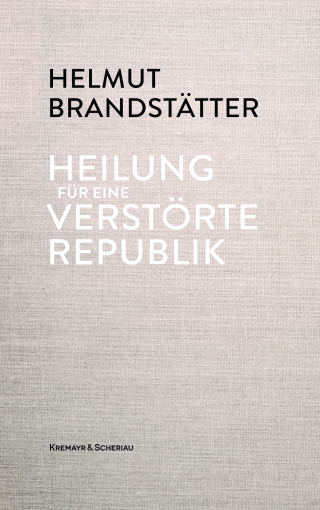







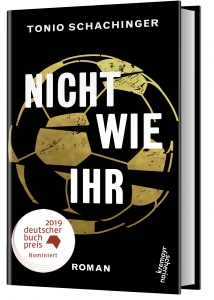 dem Auftauchen von Spielern wie David Alaba und Marko Arnautović dann zu einer Art Renaissance gekommen. Inzwischen verfolge ich hauptsächlich die Spiele des österreichischen Nationalteams. Sobald man über etwas schreibt, verändert sich sowieso noch einmal der Blickwinkel darauf. Man kann dann seinem Hobby nachgehen, also etwas machen, was man ohnehin machen würde und es als Recherche rechtfertigen, gleichzeitig ist man irgendwann auch wieder fertig damit. Ich würde nicht noch ein Buch über Fußball schreiben.
dem Auftauchen von Spielern wie David Alaba und Marko Arnautović dann zu einer Art Renaissance gekommen. Inzwischen verfolge ich hauptsächlich die Spiele des österreichischen Nationalteams. Sobald man über etwas schreibt, verändert sich sowieso noch einmal der Blickwinkel darauf. Man kann dann seinem Hobby nachgehen, also etwas machen, was man ohnehin machen würde und es als Recherche rechtfertigen, gleichzeitig ist man irgendwann auch wieder fertig damit. Ich würde nicht noch ein Buch über Fußball schreiben. pelten Leben eines Fußballstars und denen von normalen Menschen, sowie auf die Entfremdungsgefühle meines Protagonisten gegenüber seiner Umgebung. Gleichzeitig sind aber viele der Themen im Roman welche, die prinzipiell jeden Menschen betreffen können: Familie, Liebe, der Umgang mit Fremdzuschreibungen und mit der eigenen (Migrations-)Geschichte, Untreue. Dadurch kann der Titel auch ironisch gelesen werden, denn Ivo ist schon auch „wie wir“, insofern die Fragen, die ihn beschäftigen, allgemeine, über den Fußball hinausgehende sind. Das war auch eine der Sachen, die mich beim Schreiben sehr gereizt haben: zu zeigen, dass diese scheinbar so weit von jeglicher Realität entfernten Fußballer ein Identifikationspotenzial für verschiedene Arten von Leser*innen anbieten und womöglich auch interessante Sichtweisen liefern können, die über ihre gesellschaftlich zugewiesenen Rollen hinausgehen.
pelten Leben eines Fußballstars und denen von normalen Menschen, sowie auf die Entfremdungsgefühle meines Protagonisten gegenüber seiner Umgebung. Gleichzeitig sind aber viele der Themen im Roman welche, die prinzipiell jeden Menschen betreffen können: Familie, Liebe, der Umgang mit Fremdzuschreibungen und mit der eigenen (Migrations-)Geschichte, Untreue. Dadurch kann der Titel auch ironisch gelesen werden, denn Ivo ist schon auch „wie wir“, insofern die Fragen, die ihn beschäftigen, allgemeine, über den Fußball hinausgehende sind. Das war auch eine der Sachen, die mich beim Schreiben sehr gereizt haben: zu zeigen, dass diese scheinbar so weit von jeglicher Realität entfernten Fußballer ein Identifikationspotenzial für verschiedene Arten von Leser*innen anbieten und womöglich auch interessante Sichtweisen liefern können, die über ihre gesellschaftlich zugewiesenen Rollen hinausgehen.